|
|
|
|
| | B Reinm 9 = MF 153,14Zitieren |
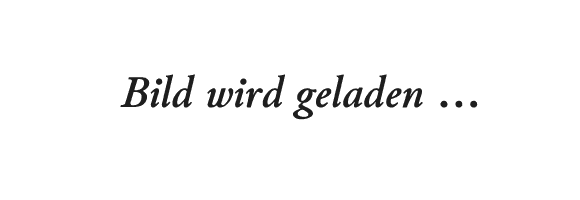
Weingartner Liederhandschrift (Stuttgart, LB, HB XIII 1), pag. 62
|
| | I |
|
|
| | [ini ##V|1|blau]vie i#st ime ze m{#v^o|uo}te, wundert mich·, |
| | dem h#erzecl{i|î}che / liep ge#schiht·? |
| | er #s{##e|æ}l{i|e}{g|c} man d{a|â} vr{o^e|öu}t er #sich·, |
| | als ich wol / w{##e|æ}ne; ich enw{ai|ei}{s|z} e{s|z} niht·. |
| | doch #s{##e|æ}he ich gerne, wie er / t{##e|æ}te·: |
| | ob er iht pfl{##e|æ}ge wunnecl{i|î}cher #st{##e|æ}te·; |
| | d{#v^i|iu} #sol ime / we#sen von rehte b{i|î}·. |
| | got gebe, da{s|z} ich erkenne noch, / wie #solichem lebenne #s{i|î}·. / |
| |
|
|
|
| |
|
|
|




