|
|
|
|
| | B Reinm 34 = MF 165,28Zitieren |
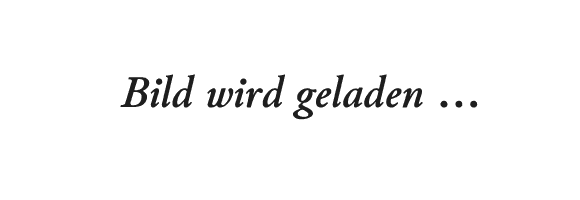
Weingartner Liederhandschrift (Stuttgart, LB, HB XIII 1), pag. 68
|
| | III |
|
|
| | [ini S|1|rot]{o|ô} wol dir, w{i|î}p, wie r{ai|ei}ne {ai|ei}n name·! |
| | wie #senf-/te d#v ze ne_mm|nn_enne #vn#d zerkennenne bi#st·. / |
| | e{s|z} wart nie niht #s{o|ô} rehte lobe#same·, |
| | d{a|â} d#v e{s|z} / an rehte g{#v^e|üe}te k{e|ê}re#st, #s{o|ô} d#v bi#st·. |
| | d{i|î}n lop mit / rede niemen wol vol<<enden kan·. |
| | #swes d#v //[69] mit tr{#v^iw|iuw}en pflige#st, wol ime, der i#st {ai|ei}n #s{##e|æ}l{i|e}{g|c} / man· |
| | #vn#d ma{g|c} vil gerne leben·. |
| | d#v g{i|î}#st al der / welte h{o|ô}hen m{#v^o|uo}t· – |
| | maht {o^v|ou}ch mir {ai|ei}n w{e|ê}n{i|e}{g|c} / vr{o^e|öu}de geben·? / |
| |
|
|
|
| |
|
|
|




